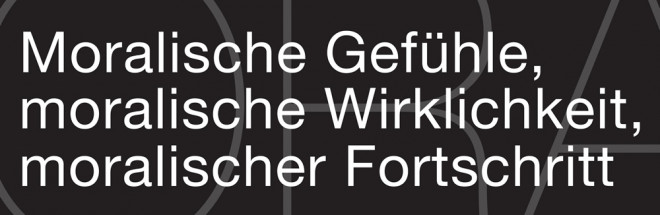#Ein Zeichen gegen das Vergessen
Inhaltsverzeichnis
„Ein Zeichen gegen das Vergessen“
Es war ein Festtag zu Ehren des Theaters. Ein Tag, der eigentlich vor vollem Haus hätte stattfinden sollen und der jetzt nach zweimaliger Verschiebung durch den unbedingten Willen aller Beteiligten als theatraler Drehtag ohne Publikum in der Berliner Volksbühne auf die Beine gestellt wurde. „Spielplanänderung“, die titelgebende Forderung der von dieser Zeitung initiierten Veranstaltung, ist schicksalhaft in Erfüllung gegangen – nur ganz anders, als die Beteiligten es sich gewünscht hätten.

Ursprünglich sollten in einer langen Nacht zu Unrecht in Vergessenheit geratene Theaterstücke zum Leben erweckt und ein Gegenangebot zum gewohnten Kanon präsentiert werden. Über die seuchenbedrohte Zeit hinweg entwickelte sich der Abend weiter, wurde zum langen Tag und zum Zeichen gegen das Vergessen des Theaters überhaupt. Trotz aller widrigen Umstände, trotz aller Risiken und gedämpften Erwartungen, die ein leeres Bühnenhaus für den Auftritt bedeutet, kamen am Wochenende gut dreißig Künstlerinnen und Künstler in der Berliner Volksbühne mit gehörigem Abstand zusammen. Intendant Klaus Dörr hatte sein Haus für einen langen Drehtag zur Verfügung gestellt, die Geldgeber – neben dem Tropen-Verlag insbesondere die Heinz und Heide Dürr Stiftung – waren nicht abgesprungen, sondern hatten sich auch mit einer filmischen Variante des ursprünglichen Vorhabens einverstanden erklärt, so dass trotz allem und gerade deshalb umso leidenschaftlicher gespielt werden konnte.
Ist das jetzt das Ende?
Man hatte als einsamer Zuschauer im Parkett des theatergeschichtlich hohen Hauses mitunter das Gefühl, einem geheimen Festakt beizuwohnen, als würde hier wie in Zeiten der Prohibition doch ein Glas ausgeschenkt, das umso köstlicher nach Freiheit schmeckt. Eingerichtet wurden die Szenen aus verschiedenen vergessenen Stücken vom Schweizer Regisseur Zino Wey, der mit großem Einsatz auf die jeweils neuen Einschränkungen reagiert und sein Regiekonzept angepasst hatte. Zu sehen war ein rasanter Wechsel aus Monologen – etwa von Stefanie Reinsperger, Patrick Güldenberg, Gina Haller und Hanns Zischler – und Ensembleszenen, unter anderem aus Else Lasker-Schülers „Wupper“ und Anna Gmeyners „Automatenbüfett“. Dörte Lyssewski und Nils Strunk spielten einen Dialog aus dem „neuen Menoza“ von Lenz, Corinna Kirchhoff und Burghart Klaußner lasen eine kurze, berührende Szene aus Turgenjews „Monat auf dem Lande“. Darin fragt der schwermütige Rakitin zum Schluss ins Leere hinein: „Ist das jetzt das Ende? Oder ein neuer Anfang?“
Um eben diese Frage nach temporärer Ausnahmezeit oder epochalem Umbruch ging es auch in einem von F.A.Z.-Herausgeber Jürgen Kaube moderiertem Streitgespräch zwischen Berlins Kultursenator Klaus Lederer, dem Leiter der Berliner Festspiele Thomas Oberender und der Schauspielerin Dörte Lyssewski, die im Moment am Burgtheater in Wien engagiert ist. In Österreich wurde kurz vor Beginn der Diskussion ein harter Lockdown beschlossen, und so stand auch dieses Gespräch unter dem Eindruck sich stetig verschärfender Einschränkungen der Kunstfreiheit. Während der Kunstanwalt und „Spielplanänderung“-Befürworter Peter Raue am Vormittag in einem Interview mit dieser Zeitung noch die „Verfassungsfeindlichkeit“ der Maßnahmen angeprangert hatte, verteidigte Festspielchef Oberender die politischen Entscheidungen zur Eindämmung der Pandemie.

Bildergalerie
:
Szenen eines Theatertages
Er und Lederer spielten sich die Bälle zu und zeigten sich ostentativ staatsmännisch und einer neuen Zukunft zugewandt. Gegen ihr gemeinsames Schwärmen für die nun anstehenden digitalen Erweiterungsmöglichkeiten an den Theatern führte Lyssewski leidenschaftlich die Unmittelbarkeit des Verwandlungsspiels ins Feld. Über den generellen gesellschaftlichen Wert des Theaters wurde man sich einig, über die Formen der Darstellungen – durch feste Ensembles oder herumziehende Gruppen, mit textunabhängigen Erzählräumen oder (vergessenen) Stücken – blieb man im Streit.
Freudiger Schauer über den Rücken
Während im Roten Salon noch trotz Abstand angeregt diskutiert wurde, baute auf der großen Bühne schon „Woods of Birnam“, die Band des Dresdner Theatermusikschauspielers Christian Friedel, auf. Und als dann gegen 21 Uhr im Saal die Lichter ausgingen und erstmals Texte der vergessenen Shakespeare-Zeitgenossin Aphra Behn erklangen, als dann Friedel mit Königskrone an die schlaglichtbeleuchtete Rampe trat und in den stockdunklen leeren Zuschauerraum hinein Macbeths Todesangst besang, da lief einem ein freudiger Schauer über den Rücken. Die spezifische Kraft des Unmittelbaren wurde von Friedel und seiner Band eindrucksvoll in Szene gesetzt. Ob sie sich nicht doch transportieren lässt? Hinein in die vielen Wohnzimmer, in denen jetzt abends die Sehnsucht nach Spiel und Kunst immer größer wird?
Digitale Live-Show diesen Sonntag
Einen Versuch ist es wert, und so wird am kommenden Sonntag von 18 bis 20 Uhr auf faz.net/theaterserie eine live moderierte Schau der Höhepunkte des Theatertages gezeigt, damit die vielen Künstlerinnen und Künstler nicht umsonst gespielt, gesungen und getanzt haben. Und die Erinnerung an die alles übertrumpfende sinnliche Kraft des Theaters eine gemeinsame wird.
Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.
Wenn Sie an Foren interessiert sind, können Sie Forum.BuradaBiliyorum.Com besuchen.
Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Nachrichten kategorie besuchen.