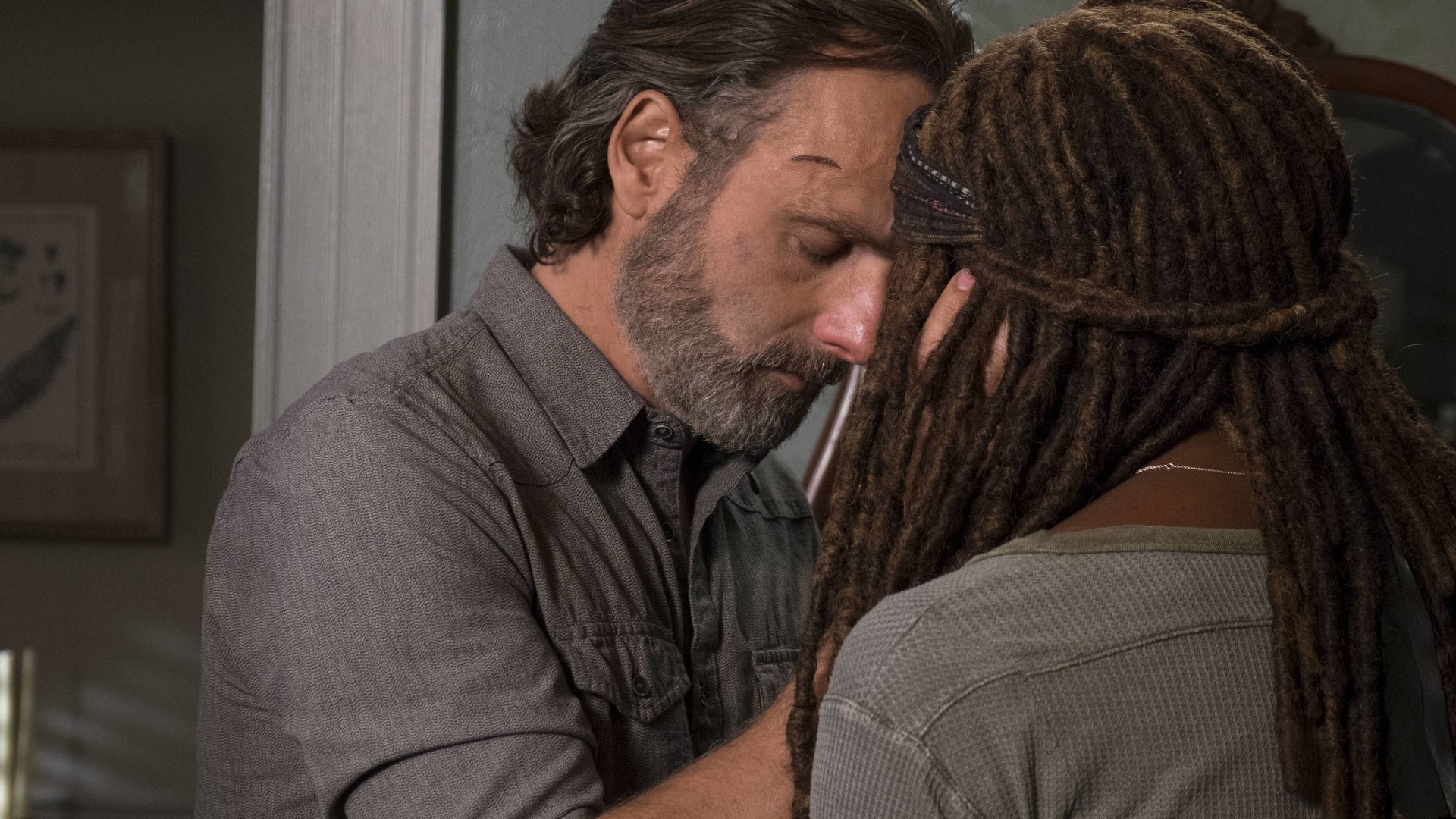#Das Licht in der Dunkelheit

Inhaltsverzeichnis
So fangen Revolutionen an. Den meisten Menschen in Deutschland ging es vor 175 Jahren wirtschaftlich nicht gut. Viele litten Not. Zu Gehör bringen konnten sie den Unmut darüber kaum. Die Presse war nicht frei. Das Regierungsmodell in den meisten Gegenden Deutschlands würde man heute als Willkürherrschaft bezeichnen. Es brodelte. Auch ihr Versprechen eines gesamtdeutschen Verfassungsstaates, den viele herbeisehnten, hatten die Herrscher nach dem Sieg über Napoleon nicht erfüllt. Deshalb waren sogar die meist begüterten Bürger in ihren Städten, die wirtschaftlichen Gewinner jener Zeit, meist unzufrieden. Die Lähmung musste sich entladen, in Versammlungen hier, in Debatten dort, hin und wieder sogar mit Gewalt, etwa beim Sturm auf die Frankfurter Konstablerwache im Jahr 1830, erfolglos. So richtig kamen die Deutschen nicht voran.
In Paris hingegen war immer etwas los. Als dort der sogenannte Bürgerkönig gestürzt wurde, sprang 1848 der revolutionäre Gedanke auch auf Deutschland über und entfaltete Kraft, endlich, wie die meisten Zeitgenossen gedacht haben dürften. Die herrschenden Fürstenhäuser wurden von der Breite der Ereignisse überrascht, manche sagen überrollt, schnell beugten sie sich den Forderungen des März 1848, gewährten Freiheiten, verfassunggebende Landtage sowie auf nationaler Ebene erstmalig ein nach allgemeinem Wahlrecht für Männer gewähltes gesamtdeutsches Parlament, das am 18. Mai 1848 in der Paulskirche in Frankfurt eröffnet wurde.
Das war eine unwahrscheinliche Wendung. Schon die Abgeordneten des Vorparlaments, das die Wahlen vorbereitet hatte, wurden in Jubelstürmen zur Paulskirche begleitet. Dann folgte die Ernüchterung. Waren in der Märzrevolution Arbeiter, Gesellen, Diener, Lehrlinge auf die Barrikaden gegangen und ums Leben gekommen, saßen in der Nationalversammlung höhere Beamte, Landräte, Richter, Staatsanwälte, Lehrer. Die Debatten im „Professorenparlament“ nahmen das Volk nicht mit. Und die konservativen Konstitutionellen aus meist bürgerlichen Kreisen, denen es vor allem darum ging, eine konstitutionelle deutsche Monarchie (ohne Österreich) zu etablieren, schafften es, den Demokraten den Schneid abzukaufen: Ordnung vor Freiheit, so die Idee.
Angst vor Aufständen und Anarchie
Auch die soziale Frage trat in den Hintergrund. Schon Juni 1849 war die historische Chance verspielt, die Nationalversammlung wurde aufgelöst. Die Mächte der Restauration nutzten die unter dem deutschen Bürgertum verbreitete Angst vor Aufständen und Anarchie. Sie hatten das Militär, bald auch wieder die Macht. Das Werk der deutschen Einigung vollendete später Otto von Bismarck, zu seinen Bedingungen.
Revolutionäre wie Robert Blum hingegen hatten es nicht geschafft. Blum war sich sicher: Erst die Segmentierung der Völker in „Stände, Bekenntnisse, Vermögensklassen, Zünfte und tausend andere Splitter“ versetze reaktionäre Regime in die Lage, einzelne Teilgruppen der Gesellschaft an sich zu binden. Mit solchen Gedanken war er nach Frankfurt gefahren. Die erste Begeisterung aber verflog auch bei ihm schon, als nur das Vorbereitungsgremium seine Arbeit aufnahm. Dennoch setzte er alles auf die parlamentarische Politik. Nur sie war aus seiner Sicht in der Lage, die anarchischen Kräfte einer zum Leben erwachenden Demokratie im Zaum zu halten.
Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.
Wenn Sie an Foren interessiert sind, können Sie Forum.BuradaBiliyorum.Com besuchen.
Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Nachrichten kategorie besuchen.