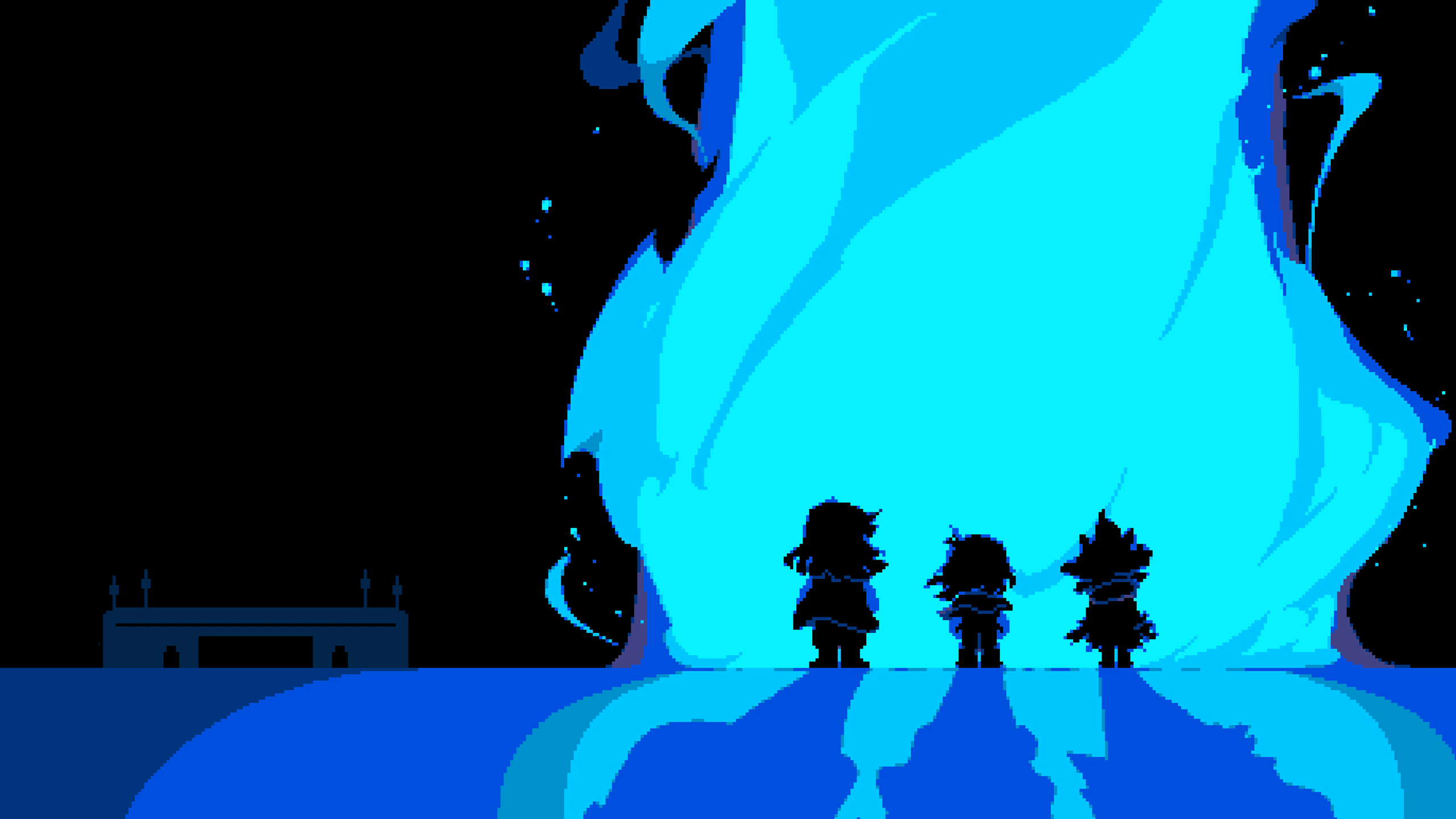#Z-Worthülsenfruchtsuppe

„Z-Worthülsenfruchtsuppe“
Dominik Köninger war nicht zu beneiden. Schon während der Ouvertüre zu Johann Strauß’ „Zigeunerbaron“ musste er sich missgelaunt auf der Bühne lümmeln, mit dem Säbel Luftlöcher schlagen, Starkprozentiges in sich hineinschütten: outrierter Aktionismus, dem dann noch eine Schlammflut hingemümmelter Verbalinjurien gegen das „Zigeunerpack“ aufgesetzt wird, das ihm, dem Grafen Homonay, seine gute alte Zeit kaputt gemacht hat, aus der nun nur noch die schmucke Husarenuniform, Schnaps und lustlose Fresserei geblieben sind.
Besser wird es mit ihm den ganzen Abend nicht mehr, und man meint dem Akteur eine bleierne Unlust anzusehen, weitere reichlich hundert Minuten – so lange dauert die pausenlos durchgespielte, ergo merklich eingedampfte Aufführung – als bornierter Dösbaddel ableisten zu müssen. Doch herunter darf er (im Libretto der Operette eher eine periphere Figur, die hier mit einem weiteren k.u.k Amtsträger zu einer zusammengezogen wurde) nicht von der Bühne der Komischen Oper, sondern muss räsonieren noch und noch: Denn er wird gebraucht als Inkarnation all jenes reaktionären Unflats, auf den sich der nachhaltige Ekel von Tobias Kratzers Inszenierung sowie des Publikums versammeln soll.
Kratzers Hoffnung mochte sein, dass sich, mit einer Konzentration aller mutmaßlichen Fragwürdigkeiten des Stücks in einem Sündenbock-Popanz politischer Inkorrektheit, der Rest der Handlung unbeschwerter erzählen ließe. Sie ging nicht auf: erstens, weil auch Reaktionäre viel mehr Spaß machen, wenn sie wenigstens einen Restbestand Intelligenz zeigen und nicht nur dumpfes Ressentiment verkörpern. Zweitens und vor allem aber, weil eine solche gleichzeitig verzagte wie klugscheißerische „Igitt“-Besserwisserei – verdichtet in der Umschreibung des Stücktitels zum „Zigeuner“baron mit Binnen-Gänsefüßchen – sich trotz des versuchten Exorzismus wie Mehltau über den ganzen Abend legte.
Sicher tat auch die Pandemie das Ihre, diese so heiß erwartete erste Berliner Opernpremiere nach der Zwangspause auf bescheiden köchelnder Flamme zu halten: Die Chöre mussten zugespielt werden, das Orchester wurde auf die Hinterbühne umgesetzt, von wo es unter Stefan Soltesz zwar gut koordiniert und mit rhythmischer Elastizität, aber auch dynamisch wie koloristisch etwas schmalbrüstig herüberkam. Und sicher sorgte der Regisseur – in Rainer Sellmaiers stimmungsarmer, auf wenige Metaphern verkürzter Ausstattung – für flott geraffte Abläufe. Doch dass er einer der originellsten Köpfe der aktuellen Szene ist, kam diesmal allenfalls in Andeutungen zum Tragen: so, wenn er das Ehestands-Couplet im letzten Akt zu einer Art Kriegerwitwen-Trostkränzchen umdeutet, bei dem kräftig gequalmt wird.
Das aber war schon die größte Inkorrektheit einer Inszenierung, die sich ansonsten ständig für das Stück (und damit quasi auch für sich selbst) zu entschuldigen scheint und damit auch dem vitalen Glutkern von Strauß’ Musik und Handlung – wie da der anarchistisch gestimmte Lebenskünstler Barinkay mit der gleichermaßen anarchistischen Emotionalität der jungen Saffi gegen alle Borniertheit und Konventionalität zu einem (vielleicht) guten Ende zusammenfindet – den Sauerstoff nahm. Individuell immerhin hielten beide Akteure der Tendenz zur Graumäusigkeit stand, wobei Mirka Wagner freilich allzu oft scheppernd ins fast Heroinenhafte hineinforcierte. Mit gutem Willen konnte man sich diese sehr eigene Vokalgestaltung als Ausdruck wild-ungezähmter Gemütsverfassung zurechthören. Thomas Blondelle hingegen brachte eine frech-frische, sonst weithin fehlende Leichtigkeit auf die Bühne, optisch als lässiger Bohemien (womit wir übers Französische schon wieder beim bösen Z-Wort sind; womöglich hat Kratzer diese semantisch-typologische Analogie bewusst angesteuert), stimmlich mit geläufigem Parlando wie blühenden Vokallinien inklusive einiger unnötiger Sentimentsschluchzer. Den Rest des Ensembles träfe am ehesten jener Befund, dem man lieber in der Medizin begegnet: unauffällig.
Aber einer verzagten Inszenierung, die, statt sich an den Geist des Originals zu halten, erst einmal zeigen will, wie übel doch rassistische Vorurteile, Schweineschlächterei (bei Zsupans per Video eingespieltem Auftrittslied müssen öfter Blutpfützen weggespült werden) und Kriegsgemetzel sind, kann vielleicht – frei nach der bekannten Luther-Sentenz – auch kein fröhlicher Gesang entfahren. Nun ist es ja so: Die 1880er Jahre, in der Strauß sein Stück schrieb, hatten ihre spezifischen Klischees und Ressentiments; wir heute haben die Unseren, die nicht unbedingt erfreulicher sind. Einer intelligenten Inszenierung kann gelingen, die Reibungspunkte damaliger und aktueller Befindlichkeiten in uns selbst produktiv zu machen. Sich aber mit dem Zeigefingergestus des heutig Besserwissenden über die damalige Ethnodekadenz gegenüber den Roma und Sinti zu überheben, in der sich, keinesfalls einschichtig, Arroganz, Faszination und kitschige Fluchtgelüste aus einer unbequem werdenden Moderne mischten und die Hunderte einschlägiger Werke in allen möglichen Gattungen generierte, ist billig. Wenn man ein Stück, wie hier geschehen, nicht aus sich selbst heraus ernst nehmen kann, soll man es lassen.
Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, vergessen Sie nicht, ihn mit Ihren Freunden zu teilen. Folgen Sie uns auch in Google News, klicken Sie auf den Stern und wählen Sie uns aus Ihren Favoriten aus.
Wenn Sie an Foren interessiert sind, können Sie Forum.BuradaBiliyorum.Com besuchen.
Wenn Sie weitere Nachrichten lesen möchten, können Sie unsere Nachrichten kategorie besuchen.